Gonbach - Vom Hanf zum Bauernleinen
Erich Glaser
Zahlreiche Wäscheschränke unserer nordpfälzischen Bauernhäuser bergen heute noch Schätze handgewebten Leinens aus vergangener Zeit; feinleinene Hemden, kräftige Handtücher, gemusterte Tischtücher, Bettücher, „Salveten" (so nannte man die Servietten) und Ballen unverarbeiteter Leinwand. Wohlgeordnet verwahrt sind sie heute noch der besondere Stolz der Hausfrau.
Über die Herstellung des schönen und kräftigen Bauernleinens wissen die meisten heutigen Menschen nur noch wenig. Es war ein langer und mühseliger Weg vom Hanf zum Leinen. Und doch gab es vor einem Menschenalter kaum einen Hof, auf dem nicht Hanf angepflanzt wurde. Ein Scherzwort sagte: „Am dritten Freitag im Mai, drei Tage vorm Regnen, wird Hanf gesät." Ende August, Anfang September war das Wachstum der blütenstaubtragenden männlichen Hanfpflanzen beendet. Wenn sie sich gelblich zu färben begannen, war die Zeit gekommen, den Hanf zu „fimmeln". Die Frauen rupften die gelb gewordenen männlichen Pflanzen, den „Fimmel", auch Femmel genannt, heraus. War der Hanfsamen reif, dann kamen die 1-2 Meter hohen weißlichen Pflanzen, „Mastel" genannt, an die Reihe. „Fimmel" und „Mastel" kamen auf eine Wiese, wo sie zum „Reizen" ausgebreitet wurden („Retzberg" bei Sippersfeld). Während vierzehn Tagen bis drei Wochen lösten sich die Basisfasern vom Mark, aber noch nicht vom Stengel. Das wurde in der „Brechkaut" mit der „Breche" besorgt. Zu¬vor mußten aber die Stengel über einem schwachen Feuer auf einem Holzrost gedörrt werden. Dann erst kamen sie in die „Brechen".
Wie das Wort sagt, wurden hier die Stengel so lange gebrochen, bis sie völlig von den Fasern abgefallen waren. Diese wurden wie ein Wollstrang zusammengedreht und kamen dann in die Hanfreibe. Solche befanden sich im Alsenztal in der Eselsmühle unterhalb Enkenbach, in Imsweiler und in Steckweiler. Auf einem kreisförmigen Stein, auf welchem die Fasern ausgebreitet wurden, lief ein vom Wasserrad getriebener, runder zweiter Stein. Durch seine Schwere drückte er die Stellen, an denen Blättchen und Seitentriebe ausgewachsen waren, so daß die Fasern ganz geschmeidig wurden. Jetzt kamen die „Hechler", meist drei Männer des Dorfes, welche das Auskämmen oder „Hecheln" auf der groben und feinen „Hechel", einem mit Eisenstiften versehenen Brett, besorgten.
Aus den Abfällen der groben Hechel, ,,Hode" genannt, stellte der Weber ein Tuch her, das zur Anfertigung von Säcken und Wagentüchern Verwendung fand. Den Abfall der feinen Hechel hieß man Werg. Aus ihm fertigte man Leintücher und leinene Sommerkleider. Die feinsten Fasern blieben zurück bei der 3. Hechel. Sie waren lang und zart und ergaben das beste Tuch für feine Hemden und Tischtücher. Nun begann das Spinnen, die Fadenbereitung auf dem Spinnrad. Wer fleißig war, konnte an einem Abend die Spule voll Garn spinnen. Etwa drei Spulen Garn haspelte man dann zu einem Strang, der später auf eine große Weberspule umgespult wurde.
Nicht in jedem Bauernhaus gab es einen Webstuhl und nicht in jedem Dorf so viele Weber wie in Gonbach. Der das schönste „Gebilde" herstellende Weber bekam die meiste Arbeit. Bei ihm bestellte die Bauersfrau „bandstreifiges Gebilde"', „Dambrettgebild" oder „Rosengebild". „Randstreifiges Gebild" zeigte bandartige Streifen, das „Dambrettgebild" die Quadrate des Dambrettes und in das „Rosengebild" hatte die Hand des Leinwebers kunstvolle Rosenmuster eingewebt.
Die ursprüngliche Farbe des Bauernleinens war grau. Ehe die Hausfrau daraus Tücher und Hemden nähen konnte, mußte das Tuch gebleicht werden. Deshalb brachte man im Sommer Stücke von 25-30 Ellen Länge auf die Wiese, breitete sie aus und übergoß sie fast stündlich mit Bachwasser. Nach einer Woche holte man das Tuch zum „Bauchen". Mit Holzasche bereitete man eine Lauge, „Sinklaa" oder ,,Laah" genannt, in welcher das Tuch zwei Tage eingeweicht wurde. Dann kam es wieder auf die Wiese zum weiteren Bleichen. Das „Bauchen" wiederholte sich so lange, bis die Leinwand die erwünschte Helle besaß.
Es war ein langer Weg vom Hanf zum Leinen. Heute wird das Spinnen und Weben in den Fabriken durch Maschinen besorgt, die schneller und genauer arbeiten als Menschenhände. Aber ganz in Vergessenheit ist das Handweben auch heute noch nicht geraten. Die Mädchen lernen es wieder am Webrahmen und oft kann man handgewebte Kissen, Deckchen oder auch Kleider sehen, die sich durch die Schönheit ihrer Muster und durch besondere Haltbarkeit auszeichnen.
Mancher alte Webstuhl steht noch verstaubt auf dem Dachboden und träumt von vergangenen Tagen. In seine Träume klingen der längst verhallte Gesang der Spinnstuben und das Surren der Spinnräder. Der alte Webstuhl lauscht. Ihm ist, als höre er die Ahnfrau sprechen: „Dies Leinen ist mein ganzer Stolz. Wir haben es selbst gewebt. Es soll unsern Tisch nur an höchsten Feiertagen schmükken."
Handwerksmeisterbuch (1724-1779)
Auf Ersuchen der Handwerksmeister von Münchweiler und Gonbach wurde von der Herrschaft Ferdinand v. Wieser eine Zunft eingerichtet.
Die Handwerksmeister:
1725 Johannes Spies, Schmied
Hans Georg Molter, Schmied u. Schlosser
Franz Nickel, Wagner
Hans Adam Schott, Leineweber
Daniel Korb, Schneider
Johannes Leib, Hufschmied
1727 Johannes Veit Riß, Leineweber
Johann Michel Eßig, Leineweber
1736 Georg Heinrich Hackenschmied, Schneidermeister
1742 Johannes Georg Schwartz, Schneidermeister
Johann Balthasar Jakob, Schneidermeister
Johann Asmus Dech, Wagner
1748 Jakob Kriegbaum, Küfermeister
1769 Stophel Spieß, Schmied
Josef Peter Scheib, Zimmermann.
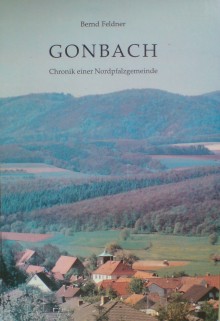
Die Ortschronik von Gonbach ist beim Bürgermeister des Ortes zu erwerben.





